Zum Besuch genötigt
 In der Rede zum Weltgericht zählt Jesus die Werke der Barmherzigkeit auf und sagt: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan (Matthäus 25,40b). Eines dieser Werke umschreibt er so: Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht.
In der Rede zum Weltgericht zählt Jesus die Werke der Barmherzigkeit auf und sagt: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan (Matthäus 25,40b). Eines dieser Werke umschreibt er so: Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht.
In der Apostelgeschichte findet sich die Situation, dass ein treuer Jünger in Damaskus – Hananias – von Jesus in einer Erscheinung den Befehl erhielt, Saulus von Tarsus zu besuchen. Dieser Saulus – wir kennen ihn unter dem Namen «Paulus» – war einer der übelsten Verfolger der Christen. Jesus selber aber erschien Saulus, als dieser auf dem Weg nach Damaskus war, um Christen zu jagen und sie gefangen nach Jerusalem zu führen. Die Erscheinung liess Saulus gesundheitlich leid verwundet zurück – er sah nichts mehr und war innerlich aufgelöst. Das, was er für richtig hielt, fiel in sich zusammen. Er musste sich neu sortieren.
Hananias wurde von Jesus zu Saulus geschickt, aber der Jünger machte Einwände geltend, die sich nicht leicht entkräften liessen. Jesus aber sprach seinem Jünger gut zu und liess ihn ahnen, dass er entschlossen war, diesen Saulus als sein auserwähltes Werkzeug zu gebrauchen. So kam es auch. Die Paulusbriefe, die wir im Neuen Testament finden, zeugen davon, die Apostelgeschichte berichtet von Paulus und seinem Wirken.
Hananias hatte einen unangenehmen Auftrag auszuführen. Wir können davon ausgehen, dass ihm die Knie schlotterten, als er an die Türe des Judas klopfte, wo Saulus untergebracht war. Hananias kniff nicht und liess Saulus wissen, dass er vom Herrn gesandt ist. Er legte ihm die Hände auf, Saulus konnte wieder sehen, liess sich taufen, ass etwas und stärkte sich.
Für die noch junge Kirche brachte dieser Besuch des Hananias bei Saulus die überraschende Wende. Indem sich Jesus Saulus «schnappte», hörte die Christenverfolgung schlagartig auf. Lukas, der die Apostelgeschichte schrieb, fasst zusammen: So hatte nun die Gemeinde Frieden … und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes (9,31).
Das Werk der Barmherzigkeit, das Hananias trotz aller Bedenken ausführte, wurde von Gott zum hohen Nutzen der Kirche gebraucht. Der Herr, dem wir durch die Taufe gehören, stellt auch in unserer Zeit Frauen, Männer und Kinder in Aufgaben hinein, die diese mehr als herausfordernd dünken. Unterschätzen wir nicht, was Gott durch das bewirkt, was Menschen im Vertrauen in Christus ins Werk setzen und mit Gehorsam gegenüber seinem Wort tun.
Pfarrer Daniel Rüegg, Synodalrat
Artikel am 13. September 2025 im Walliser Bote erschienen
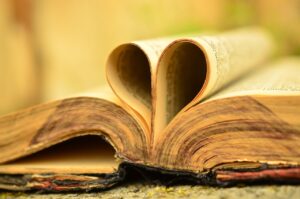 Gottlob!
Gottlob!
Wir kennen den Ausruf, verwenden ihn vielleicht selber, aber was bewegt Menschen zum ehrlichen Lob Gottes? Sind es die Oberflächlichen, Unkritischen, welche Gott loben, die Ernsthaften aber und kritische Geister halten Distanz? Das Bibelwort erdet uns auch in dieser Frage. Wir lesen in Psalm 103,2-4: Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Ge-brechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.
Es fällt uns Menschen nicht leicht, zu loben und es fällt uns erst recht nicht leicht, Gott zu loben. König David musste sich selber in Bewegung versetzen, dem Bundesgott Israels Lob zu bringen. Die eigene Seele muss ermutigt, ihr muss das Lob Gottes befohlen werden.
Warum ist das so? Wir Menschen sind vergesslich. Wir nehmen das Gute, das Gott uns zukommen lässt, gerne an, halten es vielleicht gar für alltäglich. Die Vergebung der Sünden? Für uns Christen doch eine Selbstverständlichkeit … Nein, das ist sie eben nicht, für uns nicht und für David nicht. Manche feiern den Tag ihrer Taufe, um nicht zu vergessen, dass sie Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist gehören dürfen, dass ihnen Vergebung, Leben und Heil geschenkt wurde durch Gnade. Das ist eine solide Grundlage, um zum wahren Lob Gottes zu gelangen.
David spricht von Situationen, in denen er haarscharf am Grab vorbeischrammte. Auch im Oberwallis wissen Manche zu berichten, wie ihr Leben auf Messers Schneide war und sie davonkamen. Sie wissen zu bezeugen, dass sie aus bedrängter Lage erlöst und gerettet wurden. Schauen wir auf unser Leben, so fällt auf, wie oft wir Gottes unverdientes, rettendes Eingreifen und sein Erbarmen erfahren konnten. Und wie führt uns diese Erfahrung ins Lob Gottes hinein? In schwieriger Lage starren wir Menschen hinab in den Abgrund. Gott aber Gott schlägt in seinem Erbarmen eine rettende Brücke hin zu uns. Das erkannt zu haben, führt zu Gottes Lob.
König David macht sich bewusst, wem er zu danken und wen er aus diesen Erfahrungen heraus zu loben hat. In das hinein sind auch wir gerufen. Gott zu loben, fällt uns nicht in den Schoss. Wie man einer Pumpe Wasser zuführen muss, damit sie ordentlich beginnt, Wasser zu pumpen, so braucht es auch unsere Seele, dass wir ihr Gründe nennen, die sie zum Lob Gottes führt. Wie eine Perlenkette zieht ein Grund den nächsten nach, sodass uns noch manches einfällt, wie es im Kirchenlied so passend heisst: «Gott loben, das ist unser Amt» (RG 57,5; KG 40,5).
Pfarrer Daniel Rüegg, Synodalrat
Artikel erschienen am 5. Juli 2025 im Walliser Bote
“Restauration” der Seele
Weihnachten 2024
Der morgige vierte Adventssonntag ist ein Sonntag der Freude. Das Bibelwort, das diesen Sonntag prägt, lesen wir im Brief des Paulus an die Philipper (4,4-5): Freut euch in dem Herrn allezeit, und abermals sage ich: Freut euch! Eure Güte laßt kundsein allen Menschen! Der Herr ist nahe!
Kann man Freude gebieten? Kommen Gefühle nicht einfach über uns, ob wir sie wollen oder nicht? Der Apostel nimmt die Menschen in der Kirche ernst, denn diese Frauen, Männer und Kinder sind getauft, sie sind «im Herrn», sie sind mit Christus verbunden, sie gestalten ihr Leben als Menschen, die Gott gehören. Diese Tatsache ist von den Gefühlen nicht abgekoppelt und darum kann Paulus sagen: Freut euch in dem Herrn allezeit!
Wir gehen auf Heiligabend zu. Wir werden auf die Weihnachtsgeschichte hören und wenn wir genau hinhören, merken wir, wie nüchtern uns geschildert wird, was damals in Bethlehem geschah und wie tiefgründig die Freude ist, die da anklingt. Die Engel verkünden «grosse Freude» – auch das hört sich an wie ein Befehl an die Hirten. Als diese aber von der Krippe zurück zu ihren Schafen gingen, priesen und lobten sie Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten.
Im morgigen Evangelium hören wir auf den Lobpreis der Maria, aufs Magnificat. Maria preist Gott, der sich ihr zugewandt hat und mit ihr der ganzen Gemeinde, die das Heil empfängt. Gott sendet den messianischen Retter mit dem Namen Jesus und erweist sich dadurch als der Gott unseres Heils.
Freude! Maria ahnte, dass sie als Mutter des Messias schwere Stunden auszustehen haben wird. Das wurde ihr vom alten Simeon bereits wenige Wochen nach der Geburt Jesu angekündigt. Die Freude an Gott war ihr dadurch nicht genommen.
Wir alle finden genügend Gründe, um traurig, missmutig und pessimistisch die Weihnachtstage zu durchleben. Der vierte Advent aber möchte uns vorbereiten auf ein Weihnachtsfest, an dem die Freude alles überstrahlt. Es ist die Freude im Herrn.
Diese Freude macht gütig und geduldig gegenüber unseren Nächsten, ja gegenüber allen Menschen, sagt Paulus. Die Freude gründet sich in der Hoffnung, dass unser Herr wiederkommt.
Wir sehen es allenthalben: die Herren dieser Welt gehen – früher oder später trifft es jeden. Unser Herr aber kommt. Das ist die Hoffnung und die Freude, die die Christen beseelt.
Frohe Weihnachten wünsche ich Ihnen!
Daniel Rüegg, Pfarrer und Synodalrat
Ent-sorgen
Das Bibelwort überrascht uns mit Bildern und Vergleichen, die uns sonderbar dünken. Schauen wir den Psalm 127,1-2 der so ein merkwürdiges Wort ist: Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der HERR nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, daß ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf.
Unsere Architekten, Maurer und Zimmermannen mögen sich wundern – ohne ihr Tun wird ein Haus nicht gebaut. Der Fleiss des Arbeiters, das handwerkliche Können und das Zusammenspiel der unterschiedlichen Berufe lassen ein Bauvorhaben erst gelingen. So ist es unsere Erfahrung. König Salomo, der hinter den Psalmworten steht, weiss das auch. Er selber hatte in Jerusalem grosse Bauten angestossen und vollendet, unter anderem den Tempel.
Aber kennen wir das nicht auch, dass die Dinge eben nicht zueinanderkommen wollen, dass «der Wurm» drin ist, wie wir sagen? Salomo sagt, das Gelingen steht nicht in unserer Macht. Gott schenkt uns Gesundheit und Frieden und Bewahrung. Somit ist es eben schon richtig, wenn wir sagen – Hobel und Säge vermögen nichts, wo Gott nicht der Bauleiter ist.
Salomo spricht auch von der Bewachung der Stadt: wenn nicht der Hüter, der niemals schläft und schlummert sich der Sicherheit der Menschen annimmt, gelingt auch das Wirken von Polizei, Feuerwehr und Armee nicht. Das will nicht heissen, dass ihr Tun unwichtig wäre oder dass es auf Fleiss und Anstrengung der Menschen nicht ankäme. Gewiss kommt es darauf an. Zur Verdeutlichung ist der Tagesbefehl von Oliver Cromwell, dem englischen Heerführer im 17ten Jh., ein Klassiker. Er schärfte seinen Leuten ein: «Traut auf Gott, und haltet euer Pulver trocken!»
Wir erahnen es und wissen es nur zu gut: wir Menschen sind sorgenanfällig. Darum brauchen wir eine funktionierende Entsorgung. Bei den Glasflaschen haben wir es im Griff: wir entsorgen sie bei der Sammelstelle. Die Sorgen, die uns plagen, werden nicht in Behältern weggeführt. Die Ent-sorgung, die wir benötigen, hat mit dem Vertrauen in Gott zu tun.
 Das Vertrauen in Christus führt in eine Ruhe, die uns Halt gibt und uns die Sorgen nimmt. Glaube bedeutet: wir sehen ein, dass der himmlische Vater uns liebt und wir blicken auf den, der uns liebt. Er ist mit uns, auch bei der Arbeit. Nun die Nagelprobe: der Beweis, dass wir mit Gottes Beistand rechnen, ist dann erbracht, wenn wir ihn um seinen Beistand bitten – gemeinsam im Gottesdienst und persönlich jeden Tag.
Das Vertrauen in Christus führt in eine Ruhe, die uns Halt gibt und uns die Sorgen nimmt. Glaube bedeutet: wir sehen ein, dass der himmlische Vater uns liebt und wir blicken auf den, der uns liebt. Er ist mit uns, auch bei der Arbeit. Nun die Nagelprobe: der Beweis, dass wir mit Gottes Beistand rechnen, ist dann erbracht, wenn wir ihn um seinen Beistand bitten – gemeinsam im Gottesdienst und persönlich jeden Tag.
Daniel Rüegg, Pfarrer
Einer trage des andern Last,
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
Galater 6,2
 Vater im Himmel, Du hast uns das Geheimnis Deiner Liebe aufgetan. Du hast uns Dein Herz geöffnet und Deinen Sohn geschenkt. Nun kennen wir Dich, Vater, nun wissen wir, dass nichts uns scheiden kann von Deiner Liebe. Gib, dass Deine Liebe in Tat und Wahrheit Gestalt annimmt in unserem Leben, in unserem Zusammenleben.
Vater im Himmel, Du hast uns das Geheimnis Deiner Liebe aufgetan. Du hast uns Dein Herz geöffnet und Deinen Sohn geschenkt. Nun kennen wir Dich, Vater, nun wissen wir, dass nichts uns scheiden kann von Deiner Liebe. Gib, dass Deine Liebe in Tat und Wahrheit Gestalt annimmt in unserem Leben, in unserem Zusammenleben.Ferien… Welche Freiheit?
 Für viele reimt sich Ferien auf Freiheit, und das ist auch logisch. Endlich frei von den Zwängen der Arbeit, erscheint uns die Welt anders, leichter, ja sogar sonniger. Neue Möglichkeiten eröffnen sich uns. Aber ist das wirklich so?
Für viele reimt sich Ferien auf Freiheit, und das ist auch logisch. Endlich frei von den Zwängen der Arbeit, erscheint uns die Welt anders, leichter, ja sogar sonniger. Neue Möglichkeiten eröffnen sich uns. Aber ist das wirklich so?
Auf den ersten Blick natürlich. Es ist die Zeit der langen Abende, der Reisen, des Dolce Vita. Und doch, auch wenn die Ferienzeit oft erwartet und ersehnt wird, ist sie nicht frei von Zwängen. Es gibt zwei Arten von Einschränkungen: zum einen unsere eigenen Begrenzungen und zum anderen der Druck von aussen, der uns dazu zwingt, unseren Urlaub erfolgreich zu gestalten.
In der kollektiven Vorstellung bedeutet Urlaub zu haben, wegzufahren, zu geniessen und diese Zeit maximal auszunutzen. Daran werden wir schnell erinnert, wenn wir über unseren Urlaub sprechen. Wir werden mit der Frage „Wohin gehst du?“ konfrontiert – ein kleiner Satz, der viel darüber aussagt, wie ein erfolgreicher Urlaub aussehen sollte. Um sich davon zu überzeugen, genügt ein Blick in die sozialen Netzwerke und die Veröffentlichungen unserer „Freunde“, die paradiesische Orte vorstellen, die mit Bildern verschönert werden, die oft mit Filtern bearbeitet oder nach Belieben zugeschnitten sind. Auch hier werden die Dinge kompliziert, denn wir müssen uns sofort von der durch den Flug überschatteten CO2-Bilanz befreien.
Wenn unsere Freiheit dem Druck und den Einflüssen der Gesellschaft unterliegt, sind die Zwänge oft sehr materiell: Gesundheit, Finanzen, Einsamkeit. All diese Beschränkungen scheinen heute für einen gelungenen Urlaub abstossend zu sein. Und was ist mit der Freiheit?
Sie findet sich entschieden nicht in unternommenen oder erhofften Projekten. Wenn sie irgendwo zu suchen ist, dann in der Möglichkeit, wir selbst zu sein, indem wir unsere Existenz in ihren jeweiligen Realitäten umarmen. Die Urlaubszeit sollte ein Raum sein, in dem wir ohne das Diktat von „es gilt zu“ und „ich muss“ voll und ganz leben können. Sie ist also nicht eine Freiheit des Tuns, sondern des Seins. Wir treffen hier auf ein Thema, das bereits auf den ersten Seiten der Bibel präsent ist: die eigene menschliche Berufung, Kind Gottes zu sein, in allen Aspekten unseres Lebens voll auszuleben.
Wenn die Ferien ein Raum der Freiheit sind, sollten sie vor allem eines sein: Zeit, um sich von den sozialen, familiären und beruflichen Zwängen zu lösen, die uns daran hindern, unsere Berufung als Mensch voll auszuleben. In unserem Alltag ist es oft sehr schwierig, dies zu erreichen, da wir von der Vielzahl der Beschäftigungen und Verantwortungen absorbiert werden.
Die Ferien sind nicht so sehr eine Freiheit, die man gewinnen muss, sondern vielmehr eine Freiheit, die man bekommen kann. Um sie zu empfangen, muss man eine Form der Entblössung akzeptieren, um das Wesentliche zu erleben: sich selbst, die anderen und den All-Anderen. Flugtickets, Paläste und ferne Länder können uns diese durch den Atem Gottes empfangene Freiheit nicht geben.
Gilles Cavin, Pfarrer


